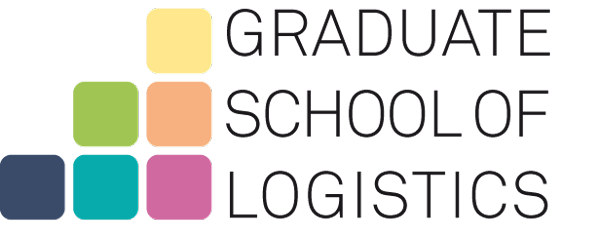Wissenschaftliche Forschung folgt oft einer scheinbar klar strukturierten Vorgehensweise: Eine Forschungslücke wird identifiziert, darauf aufbauend werden Forschungsfragen formuliert, eine geeignete Methodik entwickelt und schließlich durchgeführt, um einen wertvollen Beitrag zur wissenschaftlichen Erkenntnis zu leisten. Betrachtet man gute, wissenschaftliche Publikationen, wirkt dieser Prozess oft elegant und linear. Eine alternative Herangehensweise (vgl. [3]) ist der umgekehrte Forschungsprozess, bei dem das geplante Forschungsziel definiert wird und dann rückwärts die notwendigen Ergebnisse, Methoden, Daten und Forschungsfragen abgeleitet werden – und dann Schritt für Schritt abgearbeitet werden. Die Realität ist jedoch weit weniger gradlinig.
Tatsächliche Forschung ist iterativer, als es auf den ersten Blick scheint. Die Wahl der Forschungsfrage, die Methodik und die erzielten Ergebnisse stehen in einer wechselseitigen Abhängigkeit. Neue Erkenntnisse während des Forschungsprozesses können dazu führen, dass ursprüngliche Fragen überarbeitet oder Methoden angepasst werden müssen. Forschung ist somit kein starrer, sondern ein dynamischer Prozess.
Diese Herausforderung findet sich nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in der Praxis wieder. Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter in Unternehmen stehen vor der gleichen Problematik: Je nach definiertem Problem werden unterschiedliche Lösungen und Methoden vorgeschlagen. Doch nicht jede Methode passt zum jeweiligen Problem oder führt zu den gewünschten Ergebnissen. Ein Beispiel hierfür sind Geschäftsmodelle und Geschäftsmodellinnovationen. Hier existieren zahlreiche wissenschaftliche und praxisorientierte Ansätze – von detaillierten Werkzeugen, wie dem Business Model Canvas von Osterwalder & Pigneur [1], bis hin zu Frameworks, wie dem von Spieth und Schneider [2], welches zwei verschiedene Aggregationslevel bietet.
Jede dieser Methoden hat ihre Berechtigung, aber nicht jede Methode ist für jedes Problem gleichermaßen geeignet. Entscheidend ist, dass die gewählte Methode zur Fragestellung passt und einen sinnvollen Beitrag zur Problemlösung leistet. Ob in der Wissenschaft oder in der Praxis – die Antwort hängt von der Frage ab und der Erfolg davon, ob Problemstellung, Methodik und Zielsetzung sinnvoll aufeinander abgestimmt sind.
Referenzen:
- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers. Wiley.
- Spieth, P., & Schneider, S. (2016). Business model innovativeness: designing a formative measure for business model innovation. Journal of Business Economics, 86, 671–696.
- Hunziker, S., Blankenagel, M. (2024). Setting-Up the Research Process. In: Research Design in Business and Management. Springer Gabler, Wiesbaden.

Christian Pulat ist Corporate PhD in Kooperation mit Schenker.
In seiner Disseration befasst er sich mit den Auswirkungen der Circular Economy auf die Geschäftsmodelle von Logistikdienstleistern. Im Blog erklärt er uns, warum Lösungsprozesse in Wissenschaft und Praxis nicht linear verlaufen.