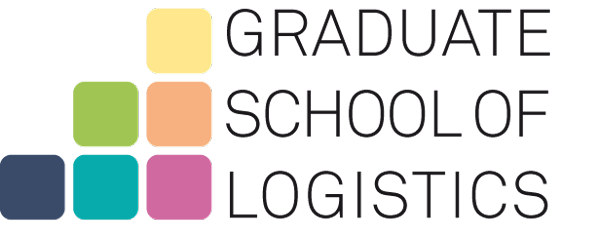Raketen, Satelliten und ihre Bestandteile sind, auch wenn die Themen Weltraum und Raumfahrt wieder an Bedeutung gewonnen haben, keine alltäglichen Güter. Ein Raketenstart und Technologie in der Umlaufbahn sowie im Weltraum sind nach wie vor Wunderwerke, deren Erfolg eine durchdachte, saubere und gutgeplante Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen erfordert. Die Bauteile kommen aus ganz unterschiedlichen Ländern und werden in verteilten Produktionsstätten zusammengebaut. Vom einfachen Kabelbaum bis zum Transport der Rakete selbst erstrecken sich komplexe Lieferkette mit enormem Aufwand, die ihres gleichen suchen.
Die Weltraumlogistik ist eine Disziplin, die auch in Hinblick auf Fragen der Nachhaltigkeit, unter höchsten Ansprüchen steht. Im Erdorbit kreisen derzeit, je nach Größe, über 36.000 bis Millionen Teile Weltraumschrott. Wir haben also nicht nur auf der Erde ein Müllproblem. Um nicht noch mehr Schrott zu produzieren, muss die Raumfahrt Technologierecycling fördern und auf Wiederverwendbarkeit von Teilen setzen. Aber der Erdorbit sollte auch aufgeräumt werden, dafür braucht es intelligente Konzepte gestützt durch innovative Technologien.
Ein Blick auf die CO2 -Bilanz verrät, jährlich ist ein Ausstoß von ca. 36.000 Tonnen Kohlenstoffdioxid zu verzeichnen. Zwar starten nur etwa 120 Raketen pro Jahr und das ist eine kleine Zahl im Vergleich zu den 100.000 Flugzeugen, die täglich starten, aber je nach Rakete werden ca. 300 Tonnen CO2 bei einer Verbrennung von ca. 4,5 Tonnen Treibstoff pro Sekunde verbraucht, das Belasten die Atmosphäre. Mit dem neuen Forschungsschub in der Raumfahrt ist es also an der Zeit für neue Antriebsformen.
Im Test sind Wasserstoff, Plasma, Ionenbetrieb und chemische Reaktionen (beispielsweise durch Zweikomponentenantriebe mit Gasen). Ein deutsches Start-up testet den Antrieb mit Kerzenwachs (Paraffin) in Kombination mit Flüssigsauerstoff. Isar Aerospace nutzte eine Kombination aus Sauerstoff und Propan für den jüngsten Test der Spectrum-Rakete in Norwegen. Für Langzeitflüge, wie bei künftigen Mars-Missionen, ist bei der NASA der Einsatz von Nuklearenergie geplant. Ob fest, flüssig oder gasförmig, der Antrieb der Zukunft sollte wesentlich nachhaltiger sein und auch einen Antrieb sowie eine Steuerung von Raketen im Weltraum ermöglichen.
Im Grunde gibt es zwei unterschiedliche Perspektiven bei der Weltraumlogistik. Einerseits braucht es Raketen, die in die Erdumlaufbahnen fliegen und hier Forschungsstationen versorgen, Müll entsorgen oder Satelliten aussetzen, dann bestenfalls in einem Stück auf die Erde zurückkommen und erneut eingesetzt werden können. Auf der anderen Seite braucht es Raketen, die weit in den Weltraum reinfliegen können und ausgelegt sind auf Missionen, die über Jahre andauern werden. Hier sind Stauraum, Versorgung, Manövrierfähigkeit, Autarkie und der bestmögliche Einsatz am „Zielort“ wichtig.
Wer sich nun fragt, was hat das alles mit Logistik zu tun, hier die Antwort: Alles. Abgesehen von den Lieferketten auf der Erde und dem Transport von Raketen, Raketenteilen und Ausstattung zum Startort, spielen der Material-, Informations- und Finanzfluss auf der Erde, im Orbit und im Weltraum eine Rolle. Die Raumfahrt wird kommerzialisiert und muss damit günstiger und effizienter werden. Es braucht eine Steigerung der Produktivität, kürzere Lieferzeiten, exakte Nachverfolgbarkeit und Transparenz. Die Grundzüge der Logistik sind auf der Erde zwar die gleichen, wie im Weltraum, aber die Auflagen, Anforderungen und die Bedingungen sind extrem.
Die Versorgung der ISS mit Nachschub ist vergleichbar mit dem Konzept einer Spedition oder eines Paketdienstes. Nur der Bote oder die Botin fährt nicht mit dem E-Auto durch Straßen, sondern mit der E-Rakete in den Orbit. Wichtige Rohstoffe kommen evtl. aus dem Weltraum und schaffen damit ein neues Verständnis von komplexen Lieferketten. Standortfragen werden zukünftig auch den Mond betreffen oder eben den Mars. Wo werden Weltraumbahnhöfe für Langzeitmissionen gebaut? Welche Lager braucht es und wie lassen sich Flug- und Raumfahrzeuge bestenfalls beladen? Was wird vor dem Start auf der Erde eingeladen, was sollte bestenfalls beim Partner im Weltraum verfügbar sein. Wie sehen die Transporteinheiten der Zukunft aus? Welche Verpackung ist bei den extremen Bedingungen sinnvoll? Wie bezahle ich für Ware im Weltraum?
Die Raumfahrt ist aber auch ein Teil der Lösung für mehr Nachhaltigkeit und Innovation auf der Erde. Ohne die zahlreichen Daten für digitale Dienste (Wetterwarnsysteme), neue Geschäftsmodelle und Technologien gingen riesige Chancen für die Entwicklung unserer Gesellschaft verloren. Kleine Trägerraketen bringen zukünftig von einer mobilen Startplattform in der Nordsee Kleinsatelliten in die Erdumlaufbahn, die Klimadaten sammeln und so entscheidende Informationen zum Klimawandel und auftretenden Klimakatastrophen liefern.
Darüber hinaus wäre ein lückenloses und transparentes Tracking von Waren nicht ohne Satelliten und 5/6 G möglich. Geo-Satelliten erweitern das 5G-Netz in besonders abgelegenen Gebieten und sorgen für Redundanz im Katastrophenfall. Bei 6G-Kommunikation werden ohnehin terrestrische und Satellitennetzte für eine globale Hochgeschwindigkeitskommunikation kombiniert. Ohne 6G werden die Smarten Cities, intelligenten Verkehrssysteme oder vernetzten Industrien unserer Zukunft nicht möglich sein. Der verstärkte Einsatz von Künstlicher Intelligenz, Robotik, IoT, Virtueller Realität, digitalen Zwillingen und Co. erfordert auch Kommunikation mit geringer Latenz.
Die Weltraumlogistik und das Management von Material-, Informations- und Finanzflüssen ist für den gesamten Globus relevant, aber insbesondere für Europa. Derzeit ist Europa von wenigen Akteuren in den USA, China und Russland abhängig und benötigt für eine zukunftsgerechte Infrastruktur und Perspektive mehr Souveränität. Diese Souveränität fängt an bei eigener Satellitenkommunikation, reicht aber bis zur Schaffung eigener Weltraumbahnhöfe und Raketen. Der Aufbau wird noch Jahre dauern, deshalb ist es um so wichtiger strategisch und strukturiert vorzugehen und das Big Picture der Zukunft schon heute mitzudenken. Nur so bleibt Europa konkurrenzfähig, spielt bei der Erschließung der neuen Märkte mit und stellt sich gegenüber politischen und ökonomischen Konflikten resilient auf.
Die Grenzen des Möglichen verschieben sich in die Unweiten des Weltalls und eröffnen damit gänzlich neue Chancen und Risiken. Der Startschuss ist bereits gefallen und die Entwicklung lässt sich nicht aufhalten. Wer die Weltraumlogistik bisher noch nicht auf dem Schirm hatte, sollte sie zumindest nicht ganz so tief im Gedächtnis vergraben, denn die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, dass neue Technologien und Geschäftsmodelle den Markt schneller umkrempeln, als erwartet.