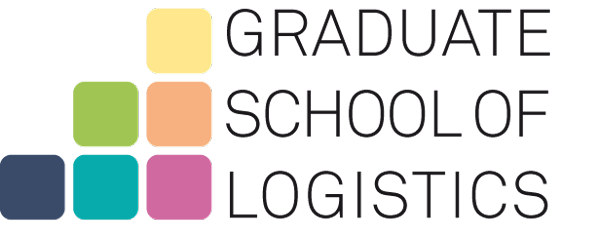Einfach zusammengefasst dreht sich bei der Demokratisierung von Künstlicher Intelligenz (KI) alles darum, die Technologie für alle zugänglich zu machen. In der Umsetzung ist das aber gar nicht so einfach, denn „alle“ umfasst eben auch alle: Bürger*innen, Schüler*innen, Studierende, kleine, mittlere und große Unternehmen, Konzerne, Mitarbeitende, öffentliche Einrichtungen, … Das Thema und die Technologie sollen nicht länger Expert*innen vorbehalten sein.
Insbesondere Generative Künstliche Intelligenz hat einen Punkt erreicht, an dem nur noch große Technologieunternehmen die erforderlichen Ressourcen haben, um KI-Modelle entwickeln und betreiben zu können. Während die einen bereits KI einsetzen, haben die anderen bestenfalls in den Nachrichten von dem Thema gelesen, kennen aber weder die Potenziale noch die Risiken der Technologie. Im Ergebnis entsteht eine sozial-ökonomische Kluft.
Um diese Kluft direkt zu Beginn auszuschließen, sollte die KI-Technologie, die auch langfristig unser Leben und Wirtschaften verändern wird, demokratisch gestaltet werden.
Es gibt unterschiedliche Sichtweisen und entsprechende Herausforderungen:
Demokratisierung der KI-Nutzung:
Die Technologie muss tatsächlich für eine breite Usergruppe zugänglich sein. Dafür müssen KI-Anwendungen u. a. auf alltäglichen Geräten genutzt werden können. Nicht jede*r hat einen Hochleistungscomputer zuhause oder am Arbeitsplatz. Anwendungen müssen also bestenfalls auf Smartphones, Tablets oder dem klassischen Heimlaptop laufen. Dann ist der Übertrag auf mobile Devices im Lager, der Produktion oder beim Transport ebenfalls kein Problem.
Demokratisierung der KI-Entwicklung:
Um KI wirklich demokratisch zu gestalten, sollten auch Ideen aus aller Welt in die Entwicklung einbezogen werden. Entwicklungsgemeinschaften bzw. Open Source Communities wären beispielsweise ein Ansatzpunkt für eine demokratische (Weiter-)Entwicklung von Anwendungen. Durch die gemeinsame Gestaltung von Lösungen wird auch das Vertrauen in die Lösungen gestärkt und gewisse Kontrollmechanismen greifen durch offenen Quellcode.
Demokratisierung der KI-Governance:
Die KI-Entwicklung, -Nutzung und -Verteilung sollten den Interessen der Gemeinschaft bzw. Gesellschaft entsprechen. Die soziale und die technologische Welt stehen in wechselseitiger Interaktion und ihre Entwicklung bedingt sich gegenseitig. Demnach sollten KI-Lösungen auch immer auf Basis der sozialen und gesellschaftlichen Anforderungen weiterentwickelt werden und sich an Recht sowie Normen orientieren. Werden Regeln und Koordinationssysteme von Ländern, Organisationen und Gesellschaft geachtet, treten auch weniger Ängste bezüglich der KI-Risiken auf. Eine Grundlage schaffen der europäische AI-ACT bzw. die deutsche KI-Verordnung.
Demokratisierung von KI-Gewinnen:
Ein Monopol einiger weniger ist im Bereich KI nicht zielführend. Es gilt die Konzentration von KI-Gewinnen auf wenige Organisationen oder Einzelpersonen zu verhindern. Gewinne auf Basis von KI sollten inklusiv und gerecht verteilt werden, sodass bestenfalls ein KI-Ökosystem entsteht. In diesem Ökosystem wird gemeinsam entwickelt, das Feedback von Expert*innen eingeholt und der entsprechende Gewinn auch fair auf alle Köpfe verteilt.
Heute stehen der Demokratisierung noch einige Hemmnisse entgegen. Dazu zählen Fragen der Datensicherheit, der Ethik oder Regulatorik, genauso wie Urheberrechtsfragen oder die Angst vor Missbrauch. Allerdings befinden sich Gesellschaft, Wirtschaft sowie Technologie in einem kontinuierlichen Transformationsprozess und der ermöglicht, die Hemmnisse Stück für Stück abzubauen und mit innovativen Ansätzen mehr Demokratie zu schaffen, wenn Führungskräfte und Management, Entwickler*innen, Politik und Gesellschaft den offenen Ansatz und das Prinzip der gemeinsamen Innovation schon heute mitdenken.